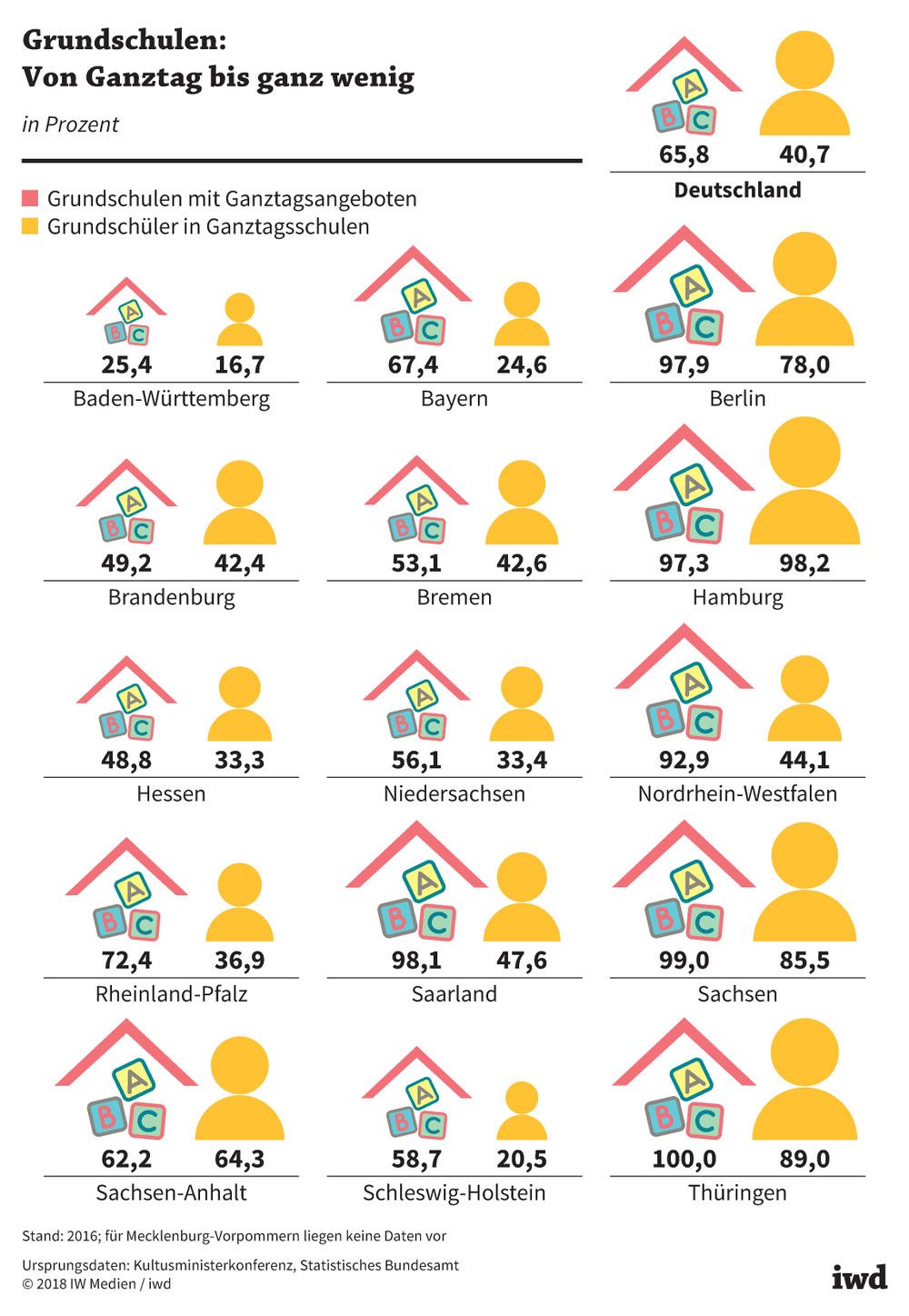…Work, Life, Balance? Familie und Beruf – beides ist mehr Erfüllung, als man stemmen kann. Frauen müssen sich entscheiden. Ein Kommentar“.
Auch wenn es zuerst den Eindruck erweckt, als gehe es vor allem um die Mütter, betrifft der Kommentar von Karin Truscheit zur vermeintlichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ebenso die Väter. Selten wurde so klar herausgestellt, dass Elternschaft eine Entscheidung verlangt, weil beides – Familie und Beruf – nicht gleichermaßen zu haben ist. Die Autorin schreibt:
„Und das ist das zweite Unerträgliche in der Debatte: das Werten und Entwerten, das Schönreden, wenn es um die Frage geht: Wie viel Karriere kann eine Mutter überhaupt machen? Man kann, als Mutter oder Vater, ganz viele Kinder haben und trotzdem eine Fernsehshow moderieren oder ein Ministerium leiten. Vorausgesetzt allerdings, die meiste Zeit kümmern sich andere um die Kinder. Karriere und Kinder finden zur gleichen Tageszeit statt.
Auch „Job-sharing“-Modelle werden dieses Dilemma kaum lösen, solange an diesen Stellen das Mutti-Etikett klebt, da es vor allem die Frauen sind, die so Karriere machen wollen. Das größte Problem bleibt jedoch selbst bei geteilten Führungspositionen die Unteilbarkeit dessen, was Kinder und Karriere gleichermaßen fordern – viel Zeit. Als Mutter oder Vater muss man sich für das eine, das Großziehen überwiegend selbst zu übernehmen, oder das andere, die klassische Karriere, entscheiden.“
Damit ist zu der Diskussion über die „Vereinbarkeit“ von Familie und Beruf (siehe hier und hier) beinahe alles gesagt – denn „vereinbar“ im Sinne der Vorstellung, beides sei gleichermaßen zu haben, sind sie nicht. Selbst allerdings wenn auf Karriere verzichtet wird, drängt einen unsere Überhöhung von Erwerbstätigkeit, uns in eine Richtung zu entscheiden. Man rechne nur einmal hoch, was es für das Familienleben heißt, vollerwerbstätig zu sein. Bei einer Arbeitszeit von 40 Stunden in der Woche ist man etwa 50 Stunden (Arbeitszeit, Pause, Pendeln zum Arbeitsplatz) abwesend von zuhause. Wer also morgens zwischen 7 und 8 Uhr aus dem Haus geht, kehrt zwischen 17 und 18 Uhr zurück. Von Stau und verspätetem Nahverkehr sehen wir ab.
Faktisch heißt das, dass der erwerbstätige Elternteil vom Familienleben so gut wie nichts mitbekommt. Für die Kinder je nach Lebensalter ist die Abwesenheit eine besonders krasse Entbehrung, denn sie haben ein unendliches Bedürfnis, mit den Eltern gemeinsam Zeit zu verbringen. Das heißt nicht, dass ständig gemeinsam gespielt oder etwas unternommen werden muss. Ansprechbar sollen Eltern sein, nah sollen sie sein, beim Spielen einfach dabeisein. An der Entbehrung ändert auch die von Bindungsforschern attestierte Bindungsfähigkeit von Kinden zu Personen außerhalb der Familie nichts. Denn diese Personen sind nicht die Eltern, von denen die Kinder sich später einmal ablösen müssen, um erwachsen zu werden. Darüber hinaus konstituieren sich die Beziehungen zu Erziehern gänzlich anders. Erzieher erbringen eine Dienstleistung, sie haben eine Dienstzeit und Feierabend, sind in ihrer Aufgabenwahrnehmung austauschbar. Sie kümmern sich um Kinder, die eine Einrichtung besuchen, ganz gleich, welche das sind. Sicher, auch ihnen wachsen die Kinder ans Herz, mit denen sie täglich Zeit verbringen, es ist letztlich aber eine Dienstleistungsbeziehung. Für die Kinder hingegen ist diese Austauschbarkeit, die zum Berufsleben dazugehört, nicht selbstverständlich, sie ist durchaus krisenhaft, denn Kinder gehen immer davon aus, dass andere ihretwegen da sind.
Wenn Eltern vollerwerbstätig sind, entbehren Kinder jemanden, der für ihr Leben zentral ist. Das ist eine Folge der Vollerwerbstätigkeit, sie ist nicht zu mildern. Der Verlust an gemeinsamer Zeit ist einer an gemeinsamer Erfahrung, sie lässt sich eben nicht organisieren (siehe hier), wie manche meinen, die die Quality Time preisen. Da Eltern in ihre Elternsein zuerst einmal hineinfinden müssen, auch das braucht Zeit, erschwert lange Abwesenheit diesen Erfahrungsprozess, der auch für Eltern krisenhaft ist, zum einen wegen den vollständig neuen Situation, der umfassenden Fremdbestimmung durch die Bedürfnisse der Kinder, zum anderen weil das Elternwerden eigene Kindheitserinnerungen verlebendigt, nicht nur angenehme, auch unangehme. Die Kinder verändern sich schnell in den ersten Jahren – und wieder braucht es Zeit, um diese Erfahrung zu machen.
Vollerwerbstätigkeit staucht die gemeinsame Zeit zusammen. Schon das gemeinsame Frühstück wird schnell hektisch (Kinder im Kitaalter spielen morgens gerne ausdauernd), das Mittagessen fällt aus und zum Abendessen ist man gerade wieder zurück. Wenn auch Teilzeittätigkeit (sofern sie von der Einkommensseite her ausreicht) mehr Zeit miteinander verschafft, erhöhrt sie den Koordinationsaufwand, es bedarf mehr Abstimmung, wodurch die gewonnene Zeit stärker organisiert werden muss. Dieser Befund besagt nicht, was jemand tun sollte, er besagt nur, was er in Kauf nehmen muss, wenn er sich für beides Familie und Beruf entscheidet. Das macht den Kommentar von Karin Truscheit so wertvoll. Sie macht klar, dass man sich entscheiden muss. Wer anderes behauptet, ist fern der Realität. Sicher kann man Kinder haben und sie durch andere versorgen lassen, um der Karriere nachzugehen. Das muss jeder selbst wissen, sollte aber nicht kleinreden, was das bedeutet.
Gleichwohl sind wir nicht so frei, diese Entscheidungen zu treffen, wie der Kommentar nahelegt, denn die Stellung von Erwerbstätigkeit ist normativ überhöht. Erwerbstätig zu sein gilt als besonders wertvoll. Wer erwerbstätig ist, macht alles richtig, auf jeden Fall leistet er etwas Sinnvolles, trägt zum Gemeinwohl bei. Das gilt für die Entscheidung, für Kinder zuhause zu bleiben, heute nicht mehr, denn die Überhöhung von Erwerbstätigkeit sorgt zugleich für eine normative Abwertung des Engagements in der Familie. Das zeigt sich in aller Deutlichkeit daran, wodurch in unseren Systemen sozialer Sicherung Ansprüche auf Einkommensleistungen erworben werden: vorrangig durch Erwerbstätigkeit. Das zeigt sich ebenso deutlich in der Bildungsrhetorik, die in Frühförderung nach wie vor das Nonplusultra erkennt.
Wenn es also um eine Entscheidung geht, die getroffen werden muss, ob und wann in welcher Lebensphase einem Beruf oder Familie wichtiger sind, dann stellt sich die Frage, wie es möglich ist, sich ihr so freigelassen wie möglich stellen zu können? Gegenwärtig stellt sich diese Entscheidung stets vor dem Hintergrund der normativen Geltung von Erwerbstätigkeit. Hier nun kommt das Bedingungslose Grundeinkommen ins Spiel, denn es zieht keine bestimmte Lebensführung einer anderen vor. Erwerbstätigkeit würde nicht mehr auf dem Sockel stehen, nicht mehr als der höchste Zweck gelten, zu dem sie heute gemacht wird. Weder nimmt ein BGE die Zumutung von einem, Entscheidungen treffen zu müssen, noch enthebt es einen der Folgen solcher Entscheidungen, die jeder aushalten muss. Es befreit jedoch von der normativen Hinleitung der Lebensführung in eine bestimmte Richtung. Nicht mehr Erwerbsätigkeit über alles würde gelten, sondern Selbstbestimmung in Gemeinschaft, denn das BGE ist eine gemeinschaftliche Angelegenheit, es ist nicht individualistisch und dennoch Individualität fördernd. Es ist nicht kollektivistisch und dennoch Vergemeinschaftung fördernd.
Sascha Liebermann