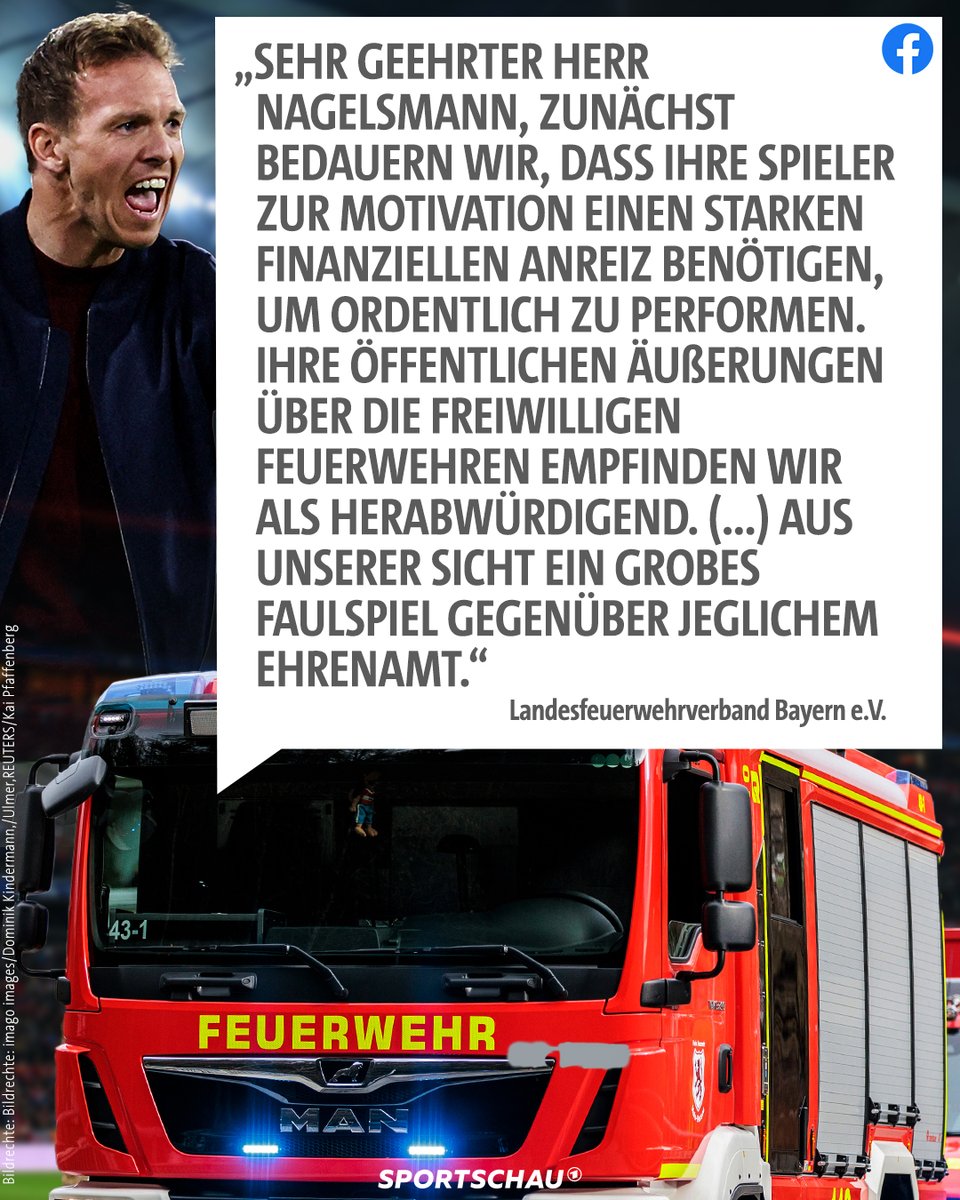= #BGE
— BGE Eisenach (@bge_esa) April 26, 2022
…so ein bekanntes Zitat der SPD-Politikerin Regine Hildebrandt, doch was hätte sie zum Bedingungslosen Grundeinkommen gesagt, hätte sie denn dafür plädiert, dass das Existenzminimum frei von Sanktionen und Bedürftigkeitsprüfung bereitgestellt werden müsste? Hätte Sie dafür plädiert, Sorgetätigkeiten zu ermöglichen auf der Basis eines auskömmlichen BGE? Manch einer (siehe auch hier), der die Würde des Individuums hochhält und Sanktionen für unangemessen erklärt, will Sanktionen doch nicht aufgeben und hält Erwerbstätigkeit für den entscheidenden Hebel, um Armut zu verhindern. Wie Frau Hildebrandt, die eine vorbehaltlose Befürworterin der Sozialhilfe war und sie für eine große Errungenschaft hielt, das gesehen hat, können wir einer Rede aus dem Jahr 1999 entnehmen:
„Ein Alltag ohne soziale Demütigung – das ist das Grundrecht aller, ausnahmslos“… weiterlesen