…unter diesem Titel in der Frankfurter Allgemeine Zeitung von Jakob Arnold (Bezahlschranke) soll Stichhaltiges dafür aufgeboten werden, dass das „Bürgergeld“ einen „Anreiz“ biete, zu kündigen. Es sei keineswegs so, wie der Bundesarbeitsminister behaupte, dass es am Bürgergeld nicht liege. Doch was bietet der Artikel dazu an Einsichten?
Das Beispiel, anhand dessen die Problematik illustriert werden soll, stammt von einem Unternehmer:
„Zuletzt habe er das mit einem Mitarbeiter aus Afghanistan erlebt. Der verdiente für eine Aushilfstätigkeit knapp 13 Euro in der Stunde, also sogar mehr als den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro. Damit sei dem Beschäftigten jedoch der Abstand zum Bürgergeld nicht mehr ausreichend gewesen. Und dann kam folgendes Kalkül hinzu, wie Krätz berichtet: Auf dem freien Mietmarkt hätte er es mit seinem Gehalt und dem nicht deutschen Namen schwer, eine bezahlbare Wohnung zu finden.
Im Bürgergeld hingegen kümmert sich der Staat um die Wohnung. Und mindestens 100 Euro könne er sogar völlig anrechnungsfrei zum Bürgergeld hinzuverdienen. Unter dem Strich stehe er damit besser da als in einem geregelten Arbeitsverhältnis mit der Pâtisserie, so Krätz.“
Der Unternehmer stellt es so dar, wir gehen einmal davon aus, dass der Mitarbeiter es auch so dargestellt hat. Zuerst heißt es, der Abstand zum Bürgergeld sei nicht mehr „ausreichend“ gewesen, der Arbeitsplatz war für den Mitarbeiter also bloß ein Einkommensplatz, mehr verband er damit nicht. Dann aber folgt der Hinweis, der weder mit dem Arbeitsplatz noch mit dem Bürgergeld direkt zu tun hat: die Lage am Wohnungsmarkt für den betreffenden Mitarbeiter, der aus Afghanistan stammt. Es geht hier also nicht einfach darum, den besseren Schnitt zu machen, wie es zuerst klingt, vielmehr hat er ein drängendes Problem, weil er aufgrund seiner Herkunft keine Wohnung findet. Ein Weg aus der Lage angesichts des ohnehin angespannten Wohnungsmarktes (der nur indirekt erwähnt wird) bietet das Bürgergeld, insofern holt er auch nicht das „Maximum“ aus dem „System“ heraus, er reagiert auf eine bedrängende Lage. In diesem Fall hätte selbst der Bezug von Wohngeld nicht geholfen, solange er keine Wohnung findet. Wäre die Lage am Wohnungsmarkt besser, hätte er diese Hilfe über den Bürgergeldbezug womöglich nicht benötigt. Festzuhalten ist, dass es gar nicht alleine um die Differenz zwischen Bürgergeld und Lohn geht (siehe die jüngste Berechnung zum Verhältnis hier und hier), sondern die Lage komplexer ist.
„Wenn es sich doch lohnt, fürs Bürgergeld zu kündigen“… weiterlesen

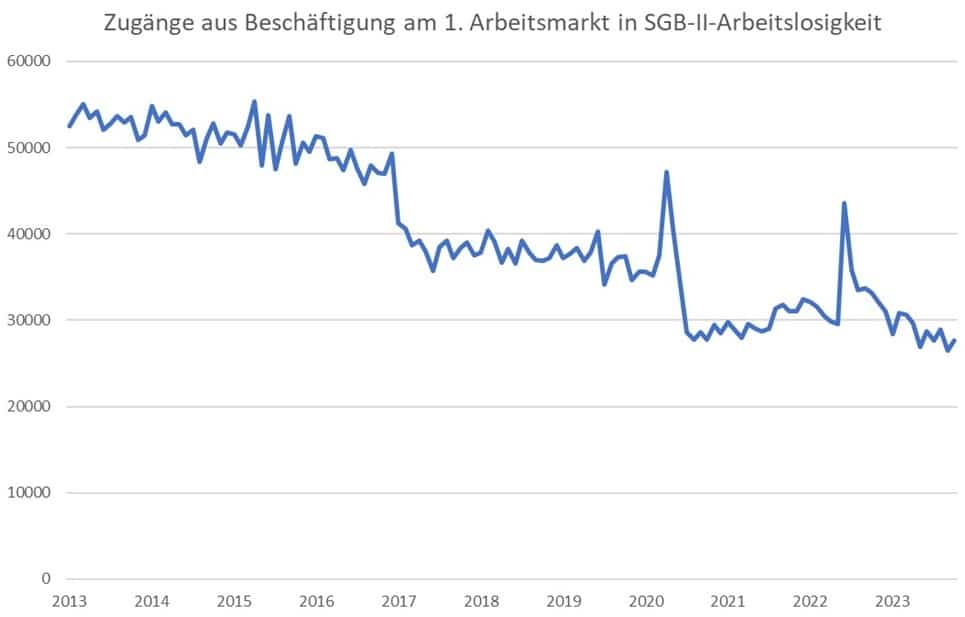 Übertitelt ist so ein
Übertitelt ist so ein