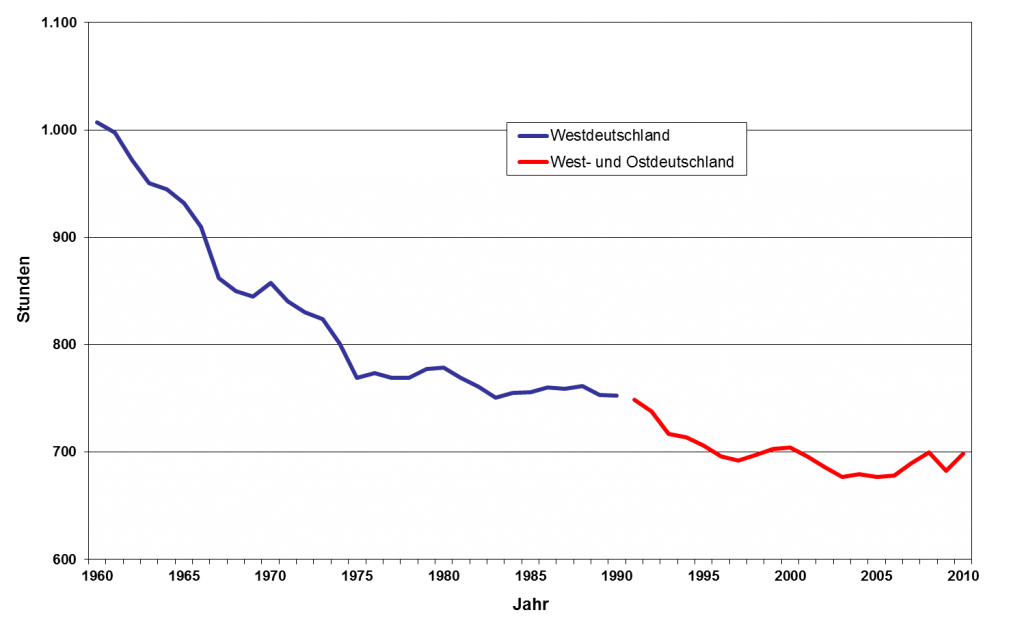…in einem Interview mit der woz. Ich kommentiere nur wenige Ausschnitte, in denen es auch um das Bedingungslose Grundeinkommen geht.
„WOZ: Sie haben einmal gesagt: Wenn in einer Familie die Zeit für unbezahlte Arbeit schrumpft, sinkt der Lebensstandard.
Madörin: Ja, wenn die Zeit nicht reicht, das tun zu können, was das Leben angenehm und die Konsumgüter konsumierbar macht, verschlechtert sich die Lebensqualität. Ich finde viele Debatten über Haus- und Familienarbeit sehr seltsam. Da wird so getan, als sei alles nur eine Frage der effizienten Organisation. Das stimmt einfach nicht. Und oft wird vor allem problematisiert, dass Frauen diese Arbeit machen. Aber ich finde andere Fragen wichtiger: Welche dieser Arbeiten sollte man bezahlen? Was wäre gerechter? Wie organisiert die Gesellschaft die Care-Arbeit, die immer teurer wird?“
Eine selten klare Haltung zur abwegigen Diskussion darüber, dass es bei diesen Tätigkeiten um eine Frage der „effizienten Organisation“ geht (siehe auch hier). Die Frage nach der Bezahlung dieser Tätigkeiten ist die Frage danach, inwiefern man die Logik der Lohnarbeit darauf ausdehnen will. Zuerst einmal wäre es wichtig, dass diejenigen, die diese Tätigkeiten gerne machen wollten, die Möglichkeiten dazu hätten, das würde ein BGE leisten. Etwas anderes ist es, diese Leistungen als Dienstleistungen einzukaufen, sie sind mit den anderen, aus einer Bindung an die Person erbrachten Leistungen nicht vergleichbar. Und genau hierin greifen die Ausführungen zu kurz, was deutlich wird, wenn familiale Beziehungen betrachtet werden. Eltern sind für Kinder nicht einfach „Care-Arbeiter“, sie sind keine Dienstleister, die zur Bewältigung einer Aufgabe angestellt oder dafür beauftragt werden. Es geht um ein Beziehungsgefüge, das aus dem Familiesein erst entsteht – Eltern sind in dieser Hinsicht nicht ersetzbar, sie sind einzigartig (siehe Beiträge dazu hier). Genau das gilt für Dienstleistungen nicht, sie werden angeboten und jemand fragt sie nach oder umgekehrt. Die Dienstleistung kennt eine geregelte Arbeitszeit, einen Feierarbend und Ferien. Wer diesen Dienst leistet, ist austauschbar, lediglich die „Chemie“ muss aufgrund der intimen Nähe stimmen.
Weiter heißt es:
„Warum wird sie [die Care-Arbeit, SL] immer teurer?
Weil sie im Gegensatz zur Güterproduktion nicht produktiver werden kann. Man kann immer billiger Smartphones herstellen, aber nicht immer billiger pflegen. Jetzt wird viel über die Roboterisierung debattiert, darüber, dass uns die Arbeit ausgehe, doch im Care-Sektor geht die Arbeit nicht aus, im Gegenteil!“
Interessant ist, dass sie vom „Care-Sektor“ spricht und durch den Vergleich mit der Produktion standardisierter Güter offenbar nur oder vor allem die erwerbstätige Form dieser Tätigkeit im Auge hat. Die Engführung Madörins wird in der nächsten Passage deutlich:
„Aber wer soll sie bezahlen?
Diese Frage müssen wir dringend diskutieren. Klar ist: Investitionen in die Care-Arbeit haben Effekte weit über den Sektor hinaus. Es gibt ein spannendes Beispiel aus Argentinien. Dort startete der Staat während der Krise um die Jahrtausendwende ein Programm: Gemeinden und Gruppen konnten Leute zum Minimallohn anstellen. Frauen in armen Quartieren organisierten bezahlte Kinderhüte- und Kochdienste. Das war ein Riesenerfolg, die beste Armutsbekämpfung. Die Frauen sagten: Erstens sieht man jetzt, wie wichtig unsere Arbeit ist, und zweitens haben wir Geld. Aber als es wieder mehr reguläre Arbeitsplätze gab, fuhr die Regierung das Projekt zurück. Die Jobs der Frauen wurden wieder zu unbezahlter Arbeit.“
Deutlich wird hier, wie sehr zwischen Ermöglichung durch leistungsunabhängige Alimentierung und Bezahlung unterschieden werden muss. Dass Madörin dies nun als Beispiel dafür angeführt wird, wie Anerkennung für eine Leistung zum Ausdruck gebracht werden könnte, ist bezeichnend. Sorgetätigkeiten würden dadurch in der Erwerbslogik anerkannt, nicht aber als Sorgetätigkeiten. Es ist doch heute hingegen gerade ein Symptom des Vorrangs von Erwerbstätigkeit, dass der größte Teil der Sorgetätigkeiten – die privaten – so gering geschätzt werden: sie gelten nicht als Arbeit, weil sie nicht bezahlt werden. Wäre es da hilfreich sie zu bezahlen statt die Stellung von Bezahlung in Frage zu stellen? Eher nicht.
„Manche Linke erhoffen sich vom bedingungslosen Grundeinkommen mehr Spielraum für die Care-Arbeit. Sie sind skeptisch.
Ja. Zum einen besteht die Gefahr, dass das Grundeinkommen zu Wohlfahrtsnationalismus führt. In Dänemark sieht man das: Das Land hat eine sehr gut organisierte Care-Ökonomie, aber immer ist die Angst da, dass einem jemand etwas wegnimmt. Wie lange müsste eine Ausländerin im Land sein, um das Grundeinkommen zu erhalten? Und weil die Kosten für die Care-Arbeit zunehmen, befürchte ich, dass mit dem Grundeinkommen eine gespaltene Gesellschaft entsteht, wie es sie heute im Ansatz schon gibt: Die Armen können sich keine personenbezogenen Dienstleistungen leisten. Wenn jemand auf Pflege angewiesen ist, reicht das Grundeinkommen nirgends hin. Was wird aus der gesellschaftlich notwendigen Arbeit?“
Der erste Teil ihrer Sorge ist einer, um den man nicht herumkommt. Weil ein Gemeinwesen eine Gemeinschaft von Gleichen ist, in der Demokratie eine Gemeinschaft von Bürgern, muss diese Gemeinschaft auch darüber befinden können, wann jemand dazugehört. Wer das nicht mehr entscheiden will, gibt Gemeinschaft auf. Ohne Gemeinschaft keine Solidarität, ohne Solidarität keine Selbstbestimmung.
Der zweite Teil ist einer, der nicht mit dem BGE zu tun hat. Weshalb sollte mit dem BGE eine gespaltene Gesellschaft entstehen? Die Frage, was wir aus dem BGE machen, ist doch eine gemeinschaftlich zu beantwortende. Dass mit ihm alleine Pflegedienstleistungen finanzierbar wären, ist abwegig. Bedacht werden muss aber, dass aufgrund eines BGE ganz andere Pflegezusammenhänge entstehen könnten, weil nun zum einen das BGE als Daueralimentierung vorhanden ist, zum anderen gewollt wird, sich zu entscheiden, wo man wirken will. Wenn also die Pflege eines Angehörigen drängt, wäre es nicht nur möglich, es wäre auch erwünscht, sich dem zu stellen.
Im folgenden Abschnitt kommt ein Aspekt zu tragen, den ich schon anderweitig behandelt habe (siehe hier und hier):
„Die Befürworter eines Grundeinkommens gehen davon aus, dass die Menschen sozial genug sind, um diese Arbeit auch ohne Bezahlung zu leisten.
Aber wer leistet sie? Zu welchen Bedingungen? Das Initiativkomitee unterschätzt diesen Sektor massiv. Sie gehen auch davon aus, dass die Leute, die mies bezahlt werden, einfach nicht mehr arbeiten gehen. Aber es gibt Arbeit, die gemacht werden muss. Wenn ich Pflege brauche, muss ich mich darauf verlassen können.
Für mich ist es ein grundlegender linker Wert, anzuerkennen, dass alle wichtig sind für die Schaffung von Reichtum, Wohlfahrt und Lebensstandard. Ich bin für die radikale Bezahlung von Arbeit. Die traditionelle Linke betrachtete Arbeit als ökonomische Frage – wie organisiert die Gesellschaft die Arbeit, zu welchen Bedingungen? Das Grundeinkommen hingegen geht vom bestehenden Markt aus.“
Auf den ersten Teil kann man nur antworten: wie soll etwas sichergestellt werden, wenn Zwang kein Weg dahin ist? Was anderes sollte es aber im Zweifelsfall heißen, wenn Madörin schreibt, dass es Arbeit gebe, die gemacht werden müsse, als Zwang auszuüben? Vermutlich würde sie das zurückweisen, sie drückt sich aber mindestens missverständlich aus. Am Ende des ersten Absatzes sagt sie dann, was die Voraussetzung ist, die nicht erzwungen werden kann: „…muss ich mich darauf verlassen können“. Der einzige Weg also, dies zu erreichen, ist, dass Verantwortung ernst- und wahrgenommen wird. Ich muss mich verlassen können, das ist aber genau, was auch heute zählt. Es reicht ja nicht, dass jemand seine Aufgabe wahrnimmt, er muss dies auch angemessen tun, gerade in diesem Bereich. – Und wenn nicht? Doch Zwang? Das eine schließt das andere aus. Wenn diese Verantwortung nicht wahrgenommen wird, dann bleibt nur der Weg, genau das zum Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzung zu machen. Dabei geht es um die Frage, wie wir leben wollen.
„Aber was ist mit denen, die nicht arbeiten können?
Es braucht auch eine gute Sozialhilfe ohne Arbeitszwang und mit einer relativ grossen Marge, die man dazuverdienen kann, ohne die Sozialhilfe zu verlieren. Aber abgesehen davon soll man Menschen einen Lohn geben für gesellschaftlich relevante Leistungen. Es gibt so viel Arbeit, die das Leben bereichern würde. Lebenssinn hat doch auch etwas mit Relevanz für die Gesellschaft zu tun.“
Eine Sozialhilfe ohne Arbeitszwang? Wer sich die Logik der Systeme sozialer Sicherung heute anschaut, wird feststellen, dass Sozialhilfe nicht als Dauerlösung konstruiert ist. Wer sie bezieht, soll langfristig auf „eigenen Beinen“ stehen können – also erwerbstätig sein. Die Stigmatisierung von Leistungsbeziehern im heutigen Gefüge ist struktureller Art. Es ist der Vorrang von Erwerbstätigkeit, der Sozialhilfe oder andere Leistungsformen zur Ausnahme erklärt. Wer sie benötigt, schafft es selbst nicht – darum geht es.
Kann es eine Sozialhilfe „ohne Arbeitszwang“ (ganz wörtlich genommen gibt es ihn heute auch nicht), eine repressionsfreie Mindestsicherung geben, die in der Erwerbslogik verbleibt? Nein. Selbst eine sehr freilassende Form der Mindestsicherung über eine Negative Einkommensteuer erhielte das Erwerbsgebot aufrecht, denn die Bereitstellung einer Gutschrift ist ausgleichender Art. Sie gleicht den mangelnden Erfolg in der Erzielung von Erwerbseinkommen aus.
Madörin hängt in der Erwerbslogik fest, was umso mehr erstaunt angesichts ihrer berechtigten Kritik am verengten Arbeitsbegriff heute. Doch die Verengung setzt sie fort, wenn sie von „gesellschaftlich relevante[n] Leistungen“ spricht. Wer definiert? Was fällt dabei unter den Tisch? Nur mit einem BGE fällt nichts unter den Tisch, sofern es eine ausreichende Höhe hätte, weil es um das Individuum in seiner Angewiesenheit auf ein Gemeinwesen geht.
Sascha Liebermann
Siehe auch die Leseprobe aus „Grundeinkommen von A bis Z“ zum Stichwort „Care“