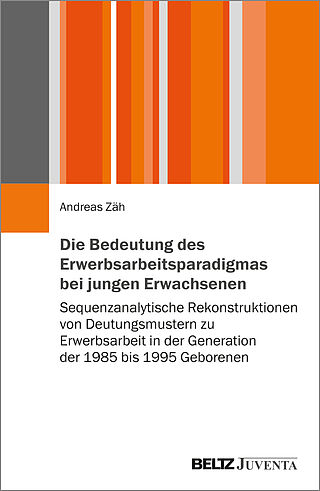 … Sequenzanalytische Rekonstruktionen von Deutungsmustern zu Erwerbsarbeit in der Generation der 1985 bis 1995 Geborenen“.
… Sequenzanalytische Rekonstruktionen von Deutungsmustern zu Erwerbsarbeit in der Generation der 1985 bis 1995 Geborenen“.
Diese von Andreas Zäh verfasste Dissertation, die kürzlich erschienen ist, ist für die gegenwärtige Diskussion um „Fördern und Fordern“, schärfere Sanktionen und das Leistungsverständnis im Allgemeinen sehr aufschlussreich, weil sie aufzeigt, wie in der untersuchten Generation das Verständnis von Leistung sich ausgeformt hat. Die Entleerung des Leistungsverständnisses wird in den Analysen eindrücklich herausgearbeitet und wirft Folgefragen auf. Wie ist es möglich, dass auf der einen Seite Leistung einen enormen Stellenwert hat, der Bezug zur Sachhaltigkeit der Leistung aber in den Interviews nicht zu erkennen ist, man eher von einer Leistungsinszenierung sprechen könnte? Welche Folgen hat dies, wenn Leistung von ihrem Sachbezug befreit wird, für ein Gemeinwesen und dessen Selbstverständnis? Man beachte hierbei, dass diese Entwicklung eine Generation betrifft, die mit der Debatte um „Hartz IV“ und „beinahe jede Arbeit ist besser als keine“ aufgewachsen ist, in der Beschäftigung entscheidend war, nicht aber, ob diese zur Wertschöpfung auch notwendig ist. Wie die jüngere Diskussion um das Bürgergeld gezeigt hat, hat sich daran nichts verändert, man könnte auch sagen, „Hartz IV“ feiere Urständ. Nicht selten wird die Neuausrichtung des Bürgergeldes ja auch damit begründet, Leistung wieder mehr Gewicht geben zu wollen, aber welcher Form von Leistung, dem Geschäftigsein, der Leistungsinszenierung oder geht es wirklich um ein sachhaltiges Verständnis davon, eines das an Problemlösung interessiert ist? Wenn letzteres gelten sollte, geht die Diskussion samt ihrer Vorschläge in die grundlegend falsch Richtung.
Sascha Liebermann
