Werner Plumpe, Prof. em., Historiker, hat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen Beitrag mit dem Titel „Wie wir fleißig wurden“ veröffentlicht, der sich mit dem Wandel der „Einstellung zur Arbeit“ befasst und in einem historischen Überblick von der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis in die Gegenwart verfolgt. Darin geht es um das Verständnis von Leistung, das vorherrschte und noch die Nachkriegszeit prägte, welche Bedeutung die Erfahrung von Knappheit und Mangel für den materiellen Wohlstandszuwachs hatte. Am Ende geht es darum, ob der Sozialstaat der Gegenwart diesbezüglich wohlstandsförderlich sei oder nicht. Im ersten Teil des Beitrags schreibt Plumpe:
„So uneinheitlich das Bild im Einzelnen ist, der Stellenwert von Arbeit scheint dennoch zurückgegangen zu sein. Um zu begreifen, welcher Wandel sich gegenwärtig vollzieht, welche Bedeutung Meinungsumfragen haben, nach denen die Bevölkerung in der Pflichterfüllung nicht mehr ihre eigentliche Herausforderung sieht, hilft es, nach den historischen Wurzeln des lange Zeit gültigen Pflichtdenkens zu fragen.“
Dass der Stellenwert von Erwerbsarbeit, nur von der ist in Plumpes Beitrag die Rede, sich verändert hat, vor allem bezüglich seines Inhaltes, ist unstrittig, seine normative Bedeutung ist hingegen stärker als früher, man muss sich nur die Erwerbsquote anschauen und die Betreuungsquote in Kitas. Erwerbstätigkeit ist nicht mehr, wie Plumpe für frühere Zeiten behauptet, der Knappheit und dem Mangel geschuldet. Meinungsumfragen sind für eine solche Einschätzung eine schlechte Quelle, weil sie oberflächliche Selbsteinschätzungen wiedergeben. Plumpe neigt teils zu einer etwas mechanischen Deutung des Wandels im Arbeitsverhalten, obwohl er zugleich auf andere Aspekte diesbezüglich hinweist, so z. B. die anfangs religiös aufgeladene Bedeutung von Arbeit, deren normative Geltung sich heute von diesen Wurzeln schon lange gelöst hat:
„Doch Forschungen zur Sozialgeschichte des Arbeitsverhaltens haben ganz eindeutig gezeigt, dass es vor allem die mit der modernen Erwerbsarbeit verbundene Zunahme von Konsumchancen etwa bei Textilien oder bei Genussmitteln wie Tee und Zucker war, die das Arbeitsverhalten vieler Menschen zunehmend änderte. “

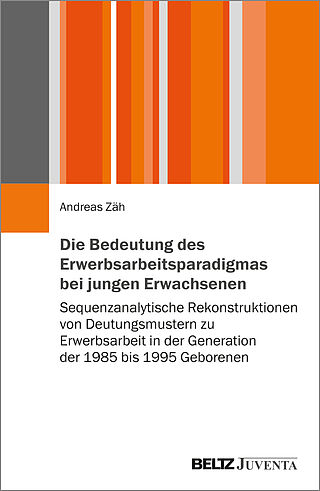 … Sequenzanalytische Rekonstruktionen von Deutungsmustern zu Erwerbsarbeit in der Generation der 1985 bis 1995 Geborenen“.
… Sequenzanalytische Rekonstruktionen von Deutungsmustern zu Erwerbsarbeit in der Generation der 1985 bis 1995 Geborenen“.