…darüber schreibt die Schauspielerin Bettina Kenter-Götte in der Freitag. Es geht um „die Martermühle“ Hartz IV und was es bedeutet, sich darin bewegen zu müssen. Aus dem Beitrag:
„Selbst für JournalistInnen ist es schwierig, Einblicke in die Realität von Hartz IV zu erhalten. Wer nicht betroffen ist, hat keinen Zutritt zu dieser Schreckenskammer der Gesellschaft – und wer dort ist, verliert die Sprache: Schockstarr kämpfen Betroffene ums tägliche Überleben, wohl wissend, dass kaum jemand ihren Geschichten Glauben schenken würde, denn sie sind fürwahr unglaublich. „Hier hast du auch was zu trinken!“, sagte ein Politiker, als er bei einem Weinfest einem Obdachlosen Sekt über den Kopf goss. Fußfesseln für Arbeitslose wurden diskutiert, ein Professor schlug vor, Arbeitslose sollten ihre Organe verkaufen (dürfen). Selbst schwangere Frauen werden „sanktioniert“. Sie können wegen Stromsperren nach Leistungskürzungen ihren Babys kein Fläschchen mehr warm machen. Ich wollte die unglaublichen Geschichten erzählen und schrieb ein Buch, wie das Alltagsleben mit Heart’s Fear wirklich ist: erniedrigend, bedrohlich, bedrückend, aussichtslos, existenzgefährdend, absurd – und mitunter auch komisch. Während einer „Aufstock“-Phase, nach einer auswärtigen Autorenlesung, musste ich mir das Geld für die Heimfahrt leihen, von einer Zuschauerin.“
Wie riskant ein Leben im Schauspielberuf ist, siehe dazu auch frühere Kommentare von uns.
Sascha Liebermann

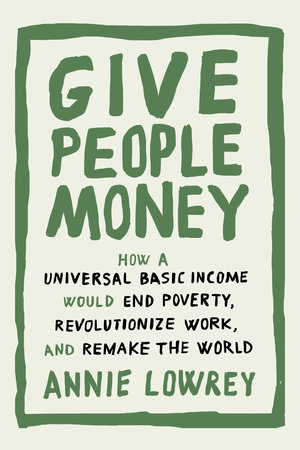 …would end poverty, revolutionize work, and remake the world“ – von Annie Lowrey. Weitere Informationen finden sich auf der
…would end poverty, revolutionize work, and remake the world“ – von Annie Lowrey. Weitere Informationen finden sich auf der 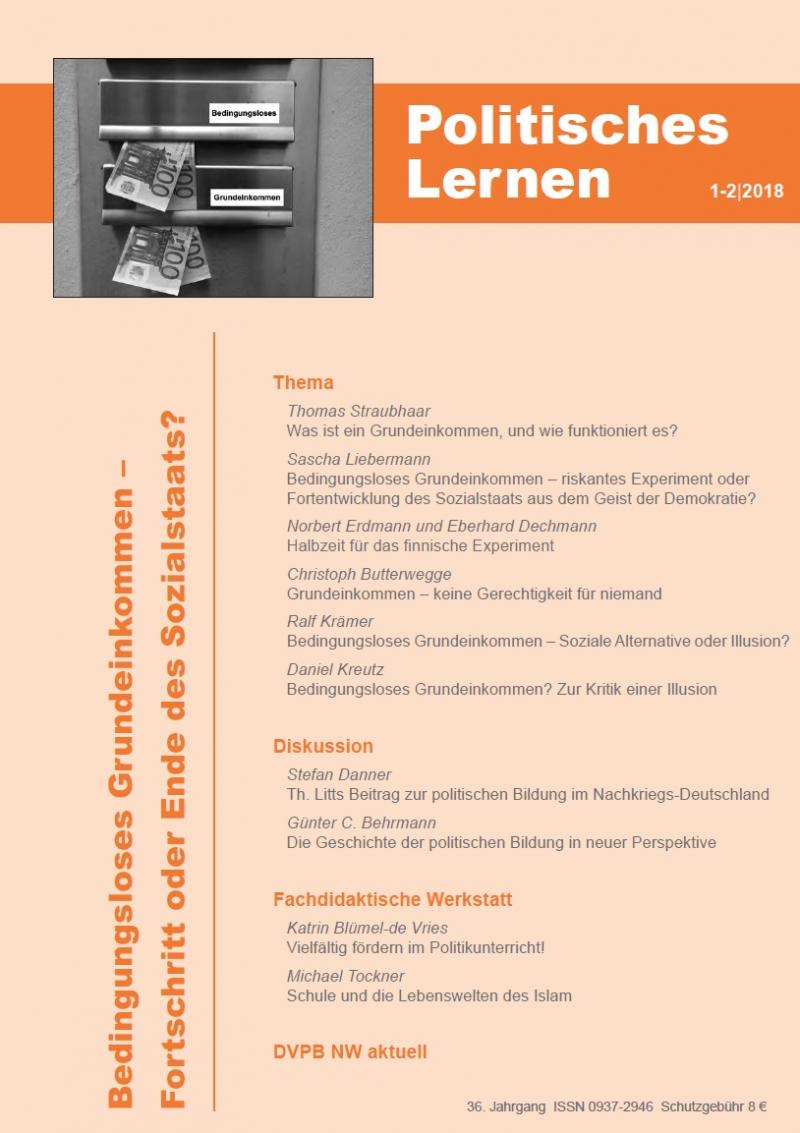 Die Zeitschrift Politisches lernen widmet sich in Ausgabe 1-2/2018 dem „Bedingungsloses Grundeinkommen – Fortschritt oder Ende des Sozialstaats?“.
Die Zeitschrift Politisches lernen widmet sich in Ausgabe 1-2/2018 dem „Bedingungsloses Grundeinkommen – Fortschritt oder Ende des Sozialstaats?“.